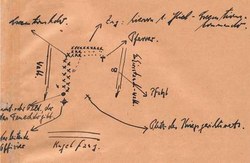30.9.-30.10.2011 - Ausstellung: "Was damals Recht war..."
Die Ausstellung
Die Wanderausstellung "Was damals Recht war...", ein Projekt der Berliner Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, ist
seit 2007 in der Bundesrepublik und in
Österreich unterwegs. Sie erinnert an die Schicksale von Männern und
Frauen, die während des Zweiten Weltkrieges von einer verbrecherischen
Militärjustiz verurteilt wurden.
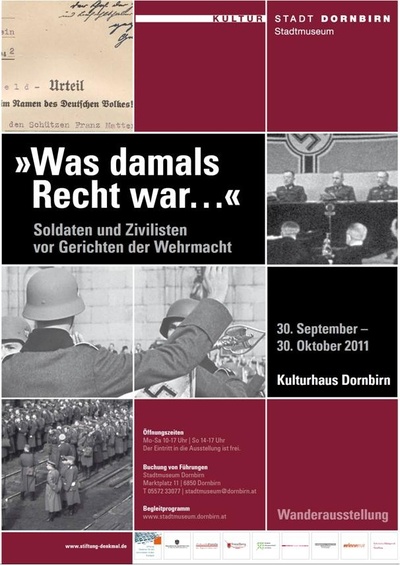
Plakat zur Ausstellung
Ursprünglich für Deutschland konzipiert, wurde die Ausstellung vom
Verein »Personenkomitee Gerechtigkeit für die Opfer der
NS-Militärjustiz« in Zusammenarbeit mit dem Verein Gedenkdienst für
Österreich adaptiert und in Wien (2009) und Klagenfurt (2010) gezeigt.
Für die Dornbirner Ausstellung wurde ein eigener Vorarlberg-Teil
konzipiert und eine Publikation über die Vorarlberger Opfer der
NS-Wehrmachtsjustiz verfasst.
Über 20.000 Todesurteile gegen Wehrmachtsangehörige wurden im „Dritten Reich“ vollstreckt. Darüber hinaus darbten und starben Tausende Soldaten und Zivilisten in den Gefängnissen der Nazis. Auch Vorarlberger wurden von den Mühlen der NS-Justiz erfasst. Beispielhafte Schicksale Vorarlberger Deserteure werden im Begleitbuch zur Ausstellung vorgestellt.
Siehe dazu den Beitrag in "Kultur" 7/2011, S. 38-40 ---> Link
Info-Folder zur Ausstellung (mit Programm) ---> Download
Vorarlberg-Teil der Ausstellung ---> Download (7 MB)
Alle Begleitveranstaltungen auf einen Blick ---> Link
Informationen für Lehrer/innen ---> Download
Pressestimmen:
Kommentar von Walter Fink in den VN vom 01.10.2011
Kommentar von Arnulf Häfele in den VN vom 24.10.2011
Berichte in VN (29.09.2011) und neue (26.10.2011)
Für die Ausstellung in Dornbirn verantwortlich: Stadtmuseum Dornbirn (Hanno Platzgummer) in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungswerk (Karin Bitschnau), der Johann-August-Malin-Gesellschaft (Kurt Greussing) und _erinnern.at_ (Werner Bundschuh).
Eröffnet wird die Ausstellung durch einen Vortrag von Harald Welzer am Do., 29. Sept. 2011 im Kulturhaus Dornbirn.

Blick auf den Vorarlberg-Teil der Ausstellung (im Hintergrund)
Begleitband für Österreich im Mandelbaum-Verlag:
GELDMACHER, Thomas / KOCH, Magnus / METZLER, Hannes / PIRKER, Peter / RETTL, Lisa (Hg.):
»Da machen wir nicht mehr mit ...« Österreichische Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht, Wien 2010.
240 Seiten, ISBN 978-3-85476-341-3, € 24.90
Das Begleitbuch dokumentiert die Lebenswege von 14 Menschen, die die
Wehrmachtsjustiz zu schweren Strafen oder zum Tode verurteilte, und
erklärt den Unrechtscharakter und die Willkür der deutschen
Militärgerichte: Es zeigt die Nazi-Richter, die über Handlungsspielräume
verfügten und doch Todesurteile aussprachen - die gleichen Richter, die
nach 1945 Karriere an Gerichten, Hochschulen und in der Politik machten
und die damit auch ein Nachkriegsdeutschland und -österreich
mitformten, die ihre Geschichte lange nicht aufzuarbeiteten begannen.
Buch wie Ausstellung nehmen die geschichtspolitischen Auseinandersetzungen um die Rehabilitierung der NS-Militärjustizopfer in den Blick und lassen Zeitzeugen zu Wort kommen.
Der zeitgeschichtliche Rahmen: »Fahnenflucht«
"Fahnenflucht" - ein
Akt des Widerstands? des Verrats? der Feigheit? des Patriotismus? Die
Einschätzung der Desertion aus der Wehrmacht ist nach wie vor
umstritten.
Wehrmachtsdeserteure waren in Deutschland und Österreich jahrzehntelang kein Thema. Ihre Weigerung, in Hitlers Vernichtungsfeldzug mitzumarschieren, blieb in der österreichischen Nachkriegsgesellschaft unbedankt und stand außerhalb der erinnerungspolitischen Wahrnehmung. Deserteure waren vielmehr mit Vorwürfen konfrontiert, sie hätten Kameraden und Vaterland verraten. Die vorherrschende Geschichtserzählung, die einerseits Österreich als das »erste Opfer der Hitlerschen Aggression« darstellte, andererseits jene Soldaten als Helden feierte, die das »Dritte Reich« bis zur Kapitulation verteidigt hatten, ließ für anderslautende Interpretationen der Vergangenheit keinen Platz.
Durch
die Marginalisierung und Verdrängung der Opfer geriet der
Unrechtscharakter der NS-Militärjustiz erst spät ins Blickfeld einer
historisch interessierten Öffentlichkeit. Über Jahrzehnte hinweg galten
die Wehrmachtgerichte als »Nische der Rechtsstaatlichkeit«. Dabei wurde
übersehen, dass die Wehrmachtsjustiz ein willfähriges Instrument des
Vernichtungskrieges war, durch deren Urteile Zehntausende Menschen –
Soldaten und ZivilistInnen – aus ganz Europa ihr Leben verloren. Die
Militärrichter vollstreckten über 15.000 Todesurteile allein an
Deserteuren.

-
Paris, April 1942: Sitzung eines deutschen Militärgerichts (Standbild aus einem zu Propagandazwecken gedrehten Film). Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin
In
Österreich begann man erst gegen Ende der 1990er Jahre, sich auf
politischer und wissenschaftlicher Ebene mit den Opfern der
NS-Militärjustiz zu beschäftigen. 2005 beschloss der Nationalrat das
»Anerkennungsgesetz«. Es beseitigte immerhin die sozialrechtliche
Schlechterstellung
der Deserteure. 2009 lieferte die Ausstellung »Was damals Recht war«
den entscheidenden Impuls zur vollständigen Rehabilitierung der
Deserteure. Sie
erfolgte mit dem »Anerkennungs- und Rehabilitationsgesetz« vom 1.
Dezember 2009. Damit erkannte die Republik Österreich Desertion aus der
Wehrmacht ausdrücklich als Akt des Widerstandes an.
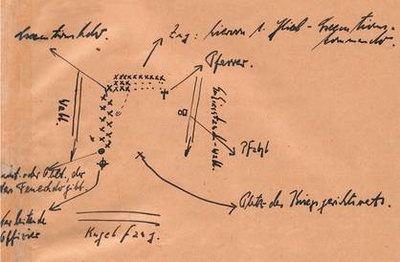
-
Skizze zum Ablauf einer Hinrichtung (aus einer Gerichtsakte, März 1942). Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg
Die Ausstellung, konzipiert von der Berliner Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, verfolgt das Ziel, die Rehabilitierung der Opfer der NS-Militärjustiz in der Öffentlichkeit voranzutreiben und zu einem würdigen Gedenken an diese Frauen und Männer beizutragen. Um die notwendige Sensibilisierung für das Thema zu erreichen, bietet die Ausstellung zielgruppengerechte Führungen sowie ein umfangreiches Begleitprogramm an.